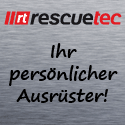Die Geschichte der Feuerwehren
 Bereits die alten Ägypter hatten die ersten organisierten Feuerlöscheinheiten.
Bereits die alten Ägypter hatten die ersten organisierten Feuerlöscheinheiten.
Im Römischen Reich entstanden Millionenstädte wie Rom. Die Häuser waren meist mehrstöckig und standen sehr eng beieinander, auch die Gassen waren sehr eng. Vielfach wurden hölzerne An- und Vorbauten an den Häusern errichtet. Etliche Male vernichteten Feuersbrünste ganze Stadtteile von Rom. Im Jahr 21 v. Chr. wurde eine erste Feuerwehr mit 600 Sklaven gegründet.
Schon im Mittelalter waren die Gemeinden verpflichtet, den Brandschutz aufzubauen. Für Feuermeldungen waren zunächst Türmer und Nachtwächter zuständig (Ruf: „Feurio!“). Im Notfall einzugreifen, wurden zuerst die Innungen und Zünfte verpflichtet. Da sehr viele Gebäude Fachwerkbauten aus Holz waren und oft innerhalb der Stadtmauern auf engstem Raum errichtet wurden, kamen Großbrände, bei denen ganze Stadtviertel abbrannten, sehr oft vor. Es wurden auch erstmals Feuerknechte in den Feuerlöschverordnungen verankert, so dass von den ersten Berufsfeuerwehren gesprochen werden kann, wie zum Beispiel in Wien 1685.
Die feuerwehrtechnische Ausrüstung war in der vorindustriellen Zeit auf einfache Hilfsmittel wie Eimer, Leitern oder Einreißhaken beschränkt. Im 17. Jahrhundert wurde der Schlauch erfunden, der zuerst aus genähtem Leder angefertigt wurde; später wurde das Leder vernietet. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurden noch Handpumpen, sogenannte Feuerspritzen verwendet, die von Pferden oder der Löschmannschaft an die Einsatzstelle gezogen wurden. Mit der Erfindung des Verbrennungsmotors verbesserte sich auch die Ausrüstung der Feuerwehren: Motorspritzen und selbstfahrende Feuerwehrfahrzeuge erhöhten die Leistungsfähigkeit um ein Vielfaches.
In den USA wurden erst Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten, privatwirtschaftlich organisierten, Berufsfeuerwehren gegründet. Teilweise wurden nur Häuser, die die Plakette eines solchen Unternehmens trugen, gelöscht.'
(Quelle: Wikipedia, ergänzt durch KFV Limburg-Weilburg)
Geschichtlicher Überblick über das Feuerlöschwesen
in Deutschland, Nassau, Hessen
und im Landkreis Limburg-Weilburg
1289: Am 14. Mai vernichtet ein verheerender Brand weite Teile der Altstadt von Limburg. Im Zuge des Wiederaufbaus entstehen später die ältesten Limburger Häuser, wie z.B. der Römer 1, ein Burgmannenhof aus dem Jahre 1296 und der Römer 2-4-6 im Jahre 1289. Beide gehören damit auch zu den ältesten Fachwerkhäusern Deutschlands.
1809: Die Nassauische Regierung verfügt, dass wegen der Feuergefahr keine Strohdächer mehr errichtet werden sollen.
1826: Die herzoglich Nassauische Regierung erlässt eine erste ausführliche Feuerpolizeiverordnung, die das Feuerlöschwesen auf Gemeindebasis regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Feuerverhütung, die Anlegung von Brandweihern und anzuschaffende Löschgeräte sowie über das Löschen von Bränden. An der Spitze der Pflichtfeuerwehr, der alle Männer vom 18 bis 40 (in Kriegszeiten bis zum 60.) Lebensjahr angehören, steht der Schultheiß (ab 1848 der Bürgermeister). Häufig bilden die sogenannten Kirchspiele einen Verband. Die wichtigste Ausrüstung bei der Brandbekämpfung stellt nach wie vor der Eimer aus Leder, Holz oder Bast dar. Jede Familie hat einen solchen Eimer zu stellen. Obwohl das Feuerlöschwesen durch die Verordnung gesetzlich geregelt ist, machen sich mangelhafte Organisation, lockere Ordnung und ungenügende Ausbildung bei Brandbekämpfungen nachteilig bemerkbar.
Um 1850: Durch die beginnende Politikverdrossenheit Mitte des 19. Jahrhunderts (Biedermeier) und die sich bildenden Turnervereine entstehen um 1850 auch die ersten Freiwilligen Feuerwehren. Diese nennen sich meist Freiwillige Rettungsschar bzw. Lösch- oder Rettungscorps. Eine der ältesten Feuerwehren auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik ist die Feuerwehr der Kreisstadt Saarlouis (gegründet 1811) im heutigen Saarland.
Die Ausrüstungen sind meist selbst bezahlt und bestehen aus nicht viel mehr als einer Uniform, Mützen und ein paar Stiefeln. Nach und nach setzen sich der Einsatz von technischem Gerät (wie Spritzen des Ingenieurs Karl Metz) und bewährte Methoden von Brandbekämpfung und Logistik durch.
1854: Die erste Berufsfeuerwehrwache in Deutschland wird in der Großen Hamburger Straße 13/14 in Berlin-Mitte ihrer Bestimmung übergeben. Anfänglich ziehen Pferdegespanne Kutschen, die um die Jahrhundertwende (Industrialisierung) auf Automobilbetrieb umgestellt werden.
1866: Nassau wird von Preußen einverleibt. Alle Männer vom 20. bis 55. Lebensjahr sind zum Brandschutz verpflichtet, soweit sie nicht durch Gesetz oder eine jährliche Ablösesumme von 3 bis 25 Mark befreit sind.
1867: In Limburg wird am 8. Februar die erste Freiwillige Feuerwehr unserer Heimat gegründet. Der Brandschutz vor der Gründung wurde vom Turnverein wahrgenommen. Anlass für die Gründung war 1866 das Geschenk der Aachener- und Münchener Feuerversicherungsgesellschaft an den Gemeinderat, eine Saug- und Druckspritze. Weitere Gründungen von Feuerwehren folgen 1869 in Hadamar sowie 1880 in Staffel und Obertiefenbach.
1872: Am 27. Juli finden sich in Wiesbaden 20 Delegierte der Freiwilligen Feuerwehren zusammen und fassen den Beschluss, einen Feuerwehrverband für den Regierungsbezirk zu gründen. Aus dem Gründungsprotokoll geht hervor, dass auch seine Majestät Kaiser Wilhelm I. anwesend war. Während der 1. Verbandsversammlung am 28. Juli in Wiesbaden wird der Nassauische Feuerwehrverband für gegründet erklärt. Aus Limburg wird Joseph Müller als Beisitzer gewählt.
1873: Der 2. Verbandstag des Nassauischen Feuerwehrverbandes findet am 2. Juni in Limburg statt. 1885: Beitritt des Nassauischen Feuerwehrverbandes zum Preußischen Landesfeuerwehrverband.
1886: Aufgrund der neuen Kreisordnung für die Provinz Hessen-Nassau, die am 1. April in Kraft tritt, entsteht der Kreis Limburg an der Lahn. Er umfasst das Amt Limburg aus dem Unterlahnkreis, das Amt Hadamar aus dem Oberlahnkreis, ohne die Gemeinden Niedertiefenbach und Waldernbach, aus dem alten Amt Idstein im Untertaunuskreis die Gemeinden Camberg, Dombach, Eisenbach, Erbach, Schwickershausen, Nieder- und Oberselters sowie Würges.
Der Oberlahnkreis wird ebenfalls nach der im Juni 1866 erfolgten Besetzung des Herzogtums Nassau durch das Königreich Preußen durch preußische Verordnung vom 22. Februar 1867 gebildet. Er besteht aus den ehemals nassauischen Ämtern Runkel, Hadamar und Weilburg. Der Sitz der Kreisverwaltung ist in Weilburg.
Bad Camberg wird von einer großen Feuersbrunst heimgesucht, die am 27. November insgesamt 19 Familien obdachlos macht. Von einem Hinterhaus in der Kirchgasse ausgehend, legen die Flammen trotz des Einsatzes der Feuerwehren aus Camberg und der Nachbarorte den Bereich zwischen Kirchgasse, Pfarrgasse und Strackgasse 42 Gebäude, darunter Stallungen und Scheunen, in denen das Feuer reiche Nahrung an den Heu- und Strohvorräten findet, in Schutt und Asche. Nur ein Haus, das mit einer Brandmauer versehen ist, entkommt dem Raub der Flammen.
1890: Die Feuerlöschverordnung legt das Alter für die Pflichtfeuerwehr auf das 20. bis 50. Lebensjahr fest. Alle Männer dieser Altersgruppen müssen in der Brandbekämpfung aktiv sein.
In diesem Jahr wird erstmals der Begriff „Verband“ für Veranstaltung innerhalb unseres jetzigen Landkreises erwähnt. Am 7. August berichtet das Weilburger Tageblatt: „Obertiefenbach, 3. August (Feuerwehrfest) Die hiesige Freiwillige Feuerwehr feierte heute in Gemeinschaft mit ihren Kameraden aus Weilburg im Wald an der Straße nach Schupbach ihr Verbandsfest. Auch die benachbarten Gesang- und Kriegervereine hatten der ergangenen Einladung Folge geleistet. Nach Abholung und Begrüßung der Gäste stand zunächst unter Leitung des Herrn Bürgermeisters Schmitt von hier auf dem Rathhaussaale eine Berathung über die inneren Angelegenheiten der beiden Feuerwehren statt. Um 3 Uhr marschirte man in geschlossenem Zuge von der Jung’schen Wirtschaft aus durch die Straßen des Orts nach dem Festplatze, wo sich eine große Menschenmenge aus den benachbarten Orten eingefunden hatte. Herr Bürgermeister Schmitt brachte das Hoch auf Se. Majestät des Kaiser und König aus, in welches die Anwesenden begeistert einstimmten. Später nahm derselbe nochmals Gelegenheit, auf die Bedeutung des Festes in einer längeren Ansprache einzugehen. …“ Im damaligen Oberlahnkreis gab es zu dieser Zeit nur diese beiden Freiwilligen Feuerwehren, wobei offenbar die Freiwillige Feuerwehr Obertiefenbach an diesem Tag ihr 10-jähriges Bestehen feierte.
1901: Am 23. Mai fällt das Kammergericht ein für die Einrichtungen von Pflichtfeuerwehren durch Polizeiverordnungen folgenschweres Urteil. Ursache ist die Weigerung eines Fleischermeisters aus Pillau, sich an einem durch Polizeiverordnung festgelegten Appell der örtlichen Pflichtfeuerwehr zu beteiligen. So können die Einwohner einer Gemeinde nicht mehr durch Polizeiverordnungen, wie es vielerorts bis dahin üblich war, zum Feuerlöschdienst verpflichtet werden. Als Folge müssen Ortsstatuten erlassen werden, in denen Regelungen, wer zum Feuerlöschdienst herangezogen wird, wie die Bedienung der Spritze, die Übungen und die Herbeischaffung von Wasser erfolgen, enthalten sind. Hierauf werden nach und nach Freiwillige Feuerwehren gebildet (bis 1900 gibt es im heutigen Landkreis Limburg-Weilburg lediglich 16 Wehren. Alleine bis 1910 kommen weitere 16 hinzu.
In Weilburg findet der 16. Verbandstag des Nassauischen Feuerwehrverbandes statt. In den „Mittheilungen für den Feuerwehrverband des Regierungsbezirks Wiesbaden“ vom 20.11.1902 ist folgendes nachzulesen:
"Bezirkseintheilung
Von verschiedenen freiwilligen Feuerwehren ist der Antrag gestellt worden, sie einem anderen Bezirk zuzutheilen, respektive in dem Bezirk zu lassen, dem sie seither angehört haben. Darauf kann jedoch nicht eingegangen werden, denn wir müssen unbedingt die gefassten Beschlüsse beachten und durchführen. Auf dem Feuerwehrtag in Weilburg wurde nun, wie Seite 8 des betr. Berichtes zu lesen ist: Der Antrag in der von Herrn Regierungsrath de la Fontaine angedeuteten Weise einstimmig angenommen. Bei der Berathung des Antrages des Centralvorstandes an Stelle des Wortes „Bezirk“ das Wort „Kreis“ in allen §§ der Verbandssatzung zu setzen machte, nach der sehr lebhaften Debatte, Herr Regierungsrath de la Fontaine den Vorschlag wie folgt zu beschließen:
Das Wort „Bezirk“ stehen zu lassen mit dem Zusatz „die Bezirke sind so einzutheilen, daß in demselben nur Wehren ein und deselben Kreises vorhanden sind.“ Hiernach ist es dem Verbands-Ausschuß unmöglich, eine andere Eintheilung zu gestatten, und bitten wir alle persönlichen, lokalen und Sonder-Interessen in dieser Sache dem Allgemeinen unterzuordnen.
Der Verbands-Ausschuß"
Beim XVI. Feuerwehrtag im Jahr 1901 in Weilburg wurde somit die Struktur der Untergliederungen des Verbandes von Bezirken (die nicht einem politischen Gebilde zugeordnet waren) auf Kreise geändert. In der Folge gründeten sich Feuerwehrbezirke, die den politischen Kreisen entsprachen. Diese Feuerwehrbezirke gingen im Sprachgebrauch in „Kreisfeuerwehrverbände“ über.
1902: Ab 23. November wird im Nassauischen Feuerwehrverband der 18. Bezirk (Oberlahn) als neuer 6. Bezirk geführt, dem nunmehr 8 freiwillige Wehren angehören. Zum gleichen Zeitpunkt werden die 14 Wehren aus dem Limburger Raum, die zuvor dem 3. Bezirk (Diez) zugeordnet waren, unter dem neu bezeichneten 7. Bezirk (Limburg) aufgelistet. Dieser Tag könnte spätestens als Gründungsdatum der beiden Kreisfeuerwehrverbände Limburg und Oberlahn gewertet werden. J. Müller aus Limburg übernimmt den Vorsitz des Kreisfeuerwehrverbandes Limburg und ist somit auch Kreisbrandmeister.
1923: Der 25. Verbandstag des Nassauischen Feuerwehrverbandes findet in Limburg statt.
1930: Der Kreis Limburg zählt 27 Mitgliedswehren in denen 1.129 Freiwillige dienen. Der Kreisverband Oberlahn umfasst 24 Wehren mit 1.011 Mitgliedern.
1933: Im heutigen Landkreis Limburg-Weilburg werden 8 Freiwillige Feuerwehren gegründet. Im Jahr 1934 folgen weitere 37 und im Jahr 1935 noch 2 weitere Gründungen.
Das Amt des Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Limburg und des Kreisbrandmeisters von Limburg wechselt vom Eschhöfer Josef Diefenbach zu Hermann Beres aus Limburg (Anmerkung: Die Arbeiten im Kreisfeuerwehrverband dürften ab diesem Zeitpunkt bis zum Kriegsende wohl weitestehend niedergelegt worden sein, zumal Beres am 18. September 1933 durch Differenzen mit der Ortspolizeibehörde um Entbindung von dem Führungsposten als Kommandant der Feuerwehr Limburg gebeten hat).
Durch die nationalsozialistische Regierung in Preußen wird am 15. Dezember das „Gesetz über das Feuerlöschwesen (FLG - Feuerlöschgesetz)“ erlassen, durch das die Stellung der Feuerwehr im öffentlichen Leben neu geregelt wird und zum 1. Januar 1934 in Kraft tritt. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr werden im Gesetz als "Polizeiexekutive besonderer Art" (auch Feuerlöschpolizei genannt, obwohl es diese Bezeichnung offiziell nicht gab) bezeichnet und den Ortspolizeiverwaltern unterstellt. Damit einhergehend verändert sich das äußerliche Erscheinungsbild der Freiwilligen Feuerwehren. Die Uniformen erhalten einen wehrmachtsähnlichen Schnitt sowie Schulterstücke. Zur ihrer Herstellung wird dunkelblaues Tuch verwendet, an die Stelle der verbreiteten Lederhelme tritt der auch bei der Wehrmacht eingeführte Stahlhelm 34 als neue Kopfbedeckung. Die Freiwilligen Feuerwehren sollen gleichzeitig als rechtsfähige Vereine in das Vereinsregister eingetragen werden. Zudem scheiden aufgrund der neu eingeführten Altersgrenze von 60 Jahren und der Überprüfung der politischen Einstellung viele Führungskräfte freiwillig bzw. zwangsweise aus dem aktiven Dienst.
Hierzu sei angemerkt:
Auch eine bisher wenig beachtete Erscheinung der damaligen Zeit drückt sich durch die Gründung von Freiwilligen Feuerwehren aus. Es war die Zeit, als der Tritt der Stiefel fanatisierter Gruppen durch die Straßen hallte. Es war die Zeit, in der ein Einzelner sich der Masse unterwerfen musste. Es war die Zeit, in der die nationalsozialistische Partei ihren Einfluss bis in die privatesten Sphären der Bürger geltend machte. Viele Bürger, die in den damaligen Geschehnissen den Beginn eines drohenden Unheils sahen, aber nicht die Möglichkeit hatten, sich dagegen zu stellen, sahen in der Gründung und in dem Eintritt zur Freiwilligen Feuerwehr die Möglichkeit, von der aktiven Mitarbeit oder Mitgliedschaft in den paramilitärischen Kampfverbänden und Organisationen der Partei verschont zu bleiben. Gerade in ländlichen Gegenden konnte der erkennbare Widerstand gegen die damaligen Machthaber den Arbeitsplatz oder gar die Existenz kosten. Die aktive Mitarbeit in einer Freiwilligen Feuerwehr entband von der Verpflichtung der Teilnahme an den verschiedensten Parteiveranstaltungen der damaligen Zeit.
1934: Der letzte Verbandstag (31.) vor Auflösung des Nassauischen Feuerwehrverbandes findet in Weilburg statt. Der Nassauische Feuerwehrverband wird am 15. April aufgelöst und die Organisation wird in den "Provinzialfeuerwehrverband Hessen-Nassau" übergeleitet. Dies ist der letzte öffentliche Auftritt des Verbandes bis zur Wiedergründung 1948.
1945: Das Kriegsende ist für die Freiwillige Feuerwehr zugleich eine Zeit des Neubeginns. Dem Wahlspruch "Gott zur Ehr’, dem Nächsten zur Wehr" getreu, wollen sie ihrer Verpflichtung wieder nachkommen. Während alle bestehenden Vereinigungen und Zusammenschlüsse zunächst einmal verboten und aufgelöst werden, ergeht am 5. April an alle Freiwilligen Feuerwehren im Regierungsbezirk Wiesbaden der Befehl Nr. 6 "Auf Anordnung der Besatzungsbehörden ist der Feuerschutz durch die bisherigen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr auszuführen". Die amerikanischen Sicherheitsoffiziere überwachen die Tätigkeit der Feuerwehr. Sie sehen in ihr eine paramilitärische Einrichtung und ordneten daher eine sofortige Trennung von Feuerwehr und Polizei an.
1948: Auf den Tag drei Jahre nach Kriegsende kommen am 8. Mai insgesamt 679 Delegierte der Freiwilligen Feuerwehren und der Werkfeuerwehren aus dem Regierungsbezirk in einer würdigen Feier in Eltville am Rhein zur Neugründung des Nassauischen Feuerwehrverbandes zusammen. Mitinitiator ist Josef Diefenbach aus Limburg-Eschhofen (1919-1933 Kommandant der Wehr Eschhofen, 1924-1933 Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband Limburg, 1946-1948 Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft der KBI im Reg. Bez. Wiesbaden, 1948-1953 Vorsitzender NFV) der auch zum Vorsitzenden gewählt wird.
Die Wehr Limburg verfügt u.a. über 5 Großlöschfahrzeuge.
1951: Am 04. Oktober wird in Limburg beschlossen, den früheren Deutschen Feuerwehrverband (DFV) wieder entstehen zu lassen, der dann am 12. Januar 1952 in Fulda wieder gegründet wird.
1952: Am 12. Januar wird in Fulda der Deutsche Feuerwehrverband e.V. wieder gegründet.
1956: Der 6. Verbandstag des Nassauischen Feuerwehrverbandes nach der Wiederbegründung findet in Elz statt. Der 7. Verbandstag im Jahr darauf in Weilburg.
1965: In Limburg verkündet Bürgermeister Kohlmaier, dass Bestrebungen im Gange sind, die Feuerwehr Limburg zu einer Stützpunktfeuerwehr zu machen. Es werden erste Überlegungen zum Neubau eines Gerätehauses für die Wehr Limburg angestellt.
1966: Am 25. Juli durchbricht frühmorgens ein auf der Autobahn auf der Heimfahrt von Österreich fahrender Brüsseler Omnibus das Geländer der Autobahnbrücke. Der mit 43 Personen besetze Bus stürzt 12 Meter tief auf die Kreisstraße zwischen Niederbrechen und Werschau. Den ersten Helfern, Einwohner der benachbarten Dörfer, die auf dem Weg zur Arbeit sind, bietet sich ein Bild des Grauens. Mit Eisensägen arbeiten sich die kurz darauf eintreffenden Helfer (Polizei, Feuerwehr und Sanitäter) durch das Gewirr aus Stahl und Blech. Verstümmelte Leiber, verrenkte Gestalten, alles blutverschmiert. Erst als ein Kranwagen eintrifft, der den auf dem Dach liegenden Bus anhebt, können die eingeschlossenen Menschen befreit und die Verletzten in die Krankenhäuser nach Limburg, Weilburg, Hadamar und Diez transportiert werden. Pfarrer Bernhard und seine Amtsbrüder geben den Sterbenden die letzte Ölung und spenden ihnen Trost. Zehn Ärzte aus den umliegenden Orten leisteten Erste Hilfe. Für 17 Insassen, meistens Kinder, kommt jede Hilfe zu spät. Weitere Kinder sterben auf dem Transport ins Krankenhaus. Insgesamt finden 33 Menschen, darunter der Fahrer des Omnibusses und die erwachsenen Begleitpersonen den Tod. Über zwei Dutzend Helfer erhalten im Nachhinein den Orden des belgischen Königs.
1971: Zur Besserung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Unfallrettungsdienstes in den Landkreisen wird vom Hessischen Innenministerium als Hauptbestandteil einer Fernmelde- und Notrufzentrale ein Funk-Kommandotisch gegen eine Überlassungsvereinbarung an den Stützpunkt der Feuerwehr Limburg durch die Fa. AEG-Telefunken geliefert und voll funktionsfähig eingebaut.
1974: Im Januar wird die erste Relaisfunkstelle für den Landkreis Limburg am Hof Beselich bei Familie Hans Lanois in Betrieb genommen. Der Stadtbrandinspektor berichtet im Februar über die geplante Umrüstung auf die Funkalarmierung. Der Landrat schreibt im März/April die Stadt Limburg wegen der Besetzung des Kommandotisches (Funkleitstelle) rund um die Uhr an.
1975: Mit der Verwaltungsreform und der damit begonnenen und durchgeführten Zusammenschlüsse der Gemeinden in den bisherigen Kreisen Limburg und Oberlahn ab dem Jahre 1971 zu Großgemeinden, begannen sich in diesen Gemeinden auch die einzelnen Freiwilligen Feuerwehren zusammenzuschließen. Mit Beschluss des Hessischen Landtages vom 6. Februar 1974 wurde ebenfalls die Neugliederung der bisherigen Landkreise Limburg und Oberlahn zum Landkreis Limburg-Weilburg beschlossen. Nun war es an der Zeit, auch die beiden Kreisfeuerwehrverbände der ehemaligen selbständigen Kreise Limburg und Oberlahn zum Kreisfeuerwehrverband Limburg-Weilburg zusammenzuführen, was nach längeren Diskussionen am 20. September in Obertiefenbach vollzogen wird. Das Amt des Kreisbrandmeisters/Kreisbrandinspektors und des Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Limburg-Weilburg wird von Ernst Joeres aus Villmar-Aumenau übernommen, Stellvertreter wird Herbert Muth aus Selters-Niederselters.
1983: In Limburg-Lindenholzhausen wird im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der dortigen Wehr der 20. Verbandstag des Nassauischen Feuerwehrverbandes gefeiert, der vor exakt 111 Jahren gegründet wurde.
1988: Im September richtet die Freiwillige Feuerwehr Limburg im Rahmen ihres 120-jährigen Bestehens den 13. Hessischen Feuerwehrtag aus.
1989: Der 23. Verbandstag des Nassauischen Feuerwehrverbandes findet in Elz statt.
2005: Im Mai Feuerwehrverbandstag wird im Rahmen der Feierlichkeiten des 100-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Hünfelden-Kirberg auch der Verbandstag des Nassauischen Feuerwehrverbandes gefeiert.
2008: Im März beschließt der Kreistag, dass auf dem Gelände der GAB (Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung, eine soziale Einrichtung des Landkreises Limburg-Weilburg) im Schlenkert in Limburg eine neue Rettungsleitstelle (Zentrale Leitstelle) und ein Verwaltungsneubau für die Bereiche öffentliche Ordnung und Soziales entstehen soll. Landrat Manfred Michel hofft auf eine Fertigstellung im Jahr 2009.
2010: Im Juni wird der Kreisfeuerwehrbverband Limburg-Weilburg vom Hessischen Minsterium des Innern und für Sport als erster Feuerwehrverband zur“ Feuerwehr des Monats“ ausgezeichnet.
2011: Geplante Einführung eines neuen gemeinsamen digitalen Funksystems in Deutschland für alle BOS.
2012: Am 23./24.03.2012 werden im Landkreis Limburg-Weilburg im Feuerwehrhaus in Weilburg die ersten beiden Einweisungen in die digitalen Funkgeräte „DIGITALFUNK ENDANWENDER-UMSCHULUNG“ durchgeführt. Danach geht es bis in den September weiter in den Kommunen Weilmünster, Weinbach, Mengerskirchen, Merenberg, Löhnberg, Waldbrunn, Dornburg, Elbtal, Hadamar, Beselich, Villmar, Runkel, Brechen, Bad Camberg, Hünfelden, Selters, Elz und Limburg. Die Ausbildung basiert auf der von einigen Kreisausbildern des Landkreises erstellten und von der Hessischen Landesfeuerwehrschule überarbeiteten und freigegebenen Schulungsunterlagen und sieht eine vierstündige theoretische Funktionseinweisung sowie eine vierstündige praktische Geräteausbildung vor. Insgesamt werden bei den Schulungen alle aktiven Sprechfunker der BOS-Einheiten, ca. 1600 Feuerwehrangehörige, 100 Kameraden des DRK, 80 des MHD, 20 des DLRG und 50 des THW ausgebildet.
2014: Am 01.04.2014 kann nun auch die Zentrale Leitstelle Limburg-Weilburg per Digitalfunk erreicht werden. Zug um Zug sollen die alten analaogen funkgeräte in den Fahrzeugen durch Digitalfunkgeräte ersetzt werden. Der analoge und der digitale Funkverkehrskreis sind auf der Leitstelle zusammengeschaltet, so dass über beide Wege die Leitstelle und alle Kommunikationspartner erreicht werden können.
2015: Am 24.07.2015 wird in Limburg-Staffel durch Einheiten das Katastrophenschutzes des Landkreises Limburg-Weilburg eine Zeltstadt zur Aufnahme von Flüchtlingen errichtet. Im September folgen die Einrichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen in Weilburg-Waldhausen und im Dezember in Runkel-Dehrn. Auch hierbei helfen zahlrieche Feuerwehrleute mit.
(Quelle: www.lindenholzhausen.de - (c) Bernd Rompel - mit freundlicher Genehmigung des Autors)
[Hier] finden Sie weitere Angaben zur Historie des Kreisfeuerwehrverbandes Limburg-Weilburg.
 [Hier] auf unserer Seite "Die Feuerwehren im Landkreis Limburg-Weilburg" haben wir alle Informationen und Ansprechpartner unserer Feuerwehren aufgelistet. Klicke einfach auf die Feuerwehr Deines Ortes!
[Hier] auf unserer Seite "Die Feuerwehren im Landkreis Limburg-Weilburg" haben wir alle Informationen und Ansprechpartner unserer Feuerwehren aufgelistet. Klicke einfach auf die Feuerwehr Deines Ortes!














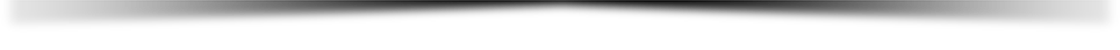

 Zum Herbeirufen von Hilfe wurde europaweit der Notruf unter der Rufnummer
Zum Herbeirufen von Hilfe wurde europaweit der Notruf unter der Rufnummer 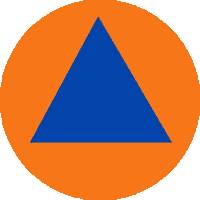
 Denken Sie immer daran: Auch Sie könnten einmal Opfer werden und auf schnelle Hilfe oder Unterstützung durch die Feuerwehr angewiesen sein.
Denken Sie immer daran: Auch Sie könnten einmal Opfer werden und auf schnelle Hilfe oder Unterstützung durch die Feuerwehr angewiesen sein. Aufgrund fehlender Investitionen von Seiten der Träger des Brandschutzes (Kommunen, Städte), ist es einigen Freiwilligen Feuerwehren heutzutage nicht mehr möglich, ihre Aufgaben wirkungsvoll und der Gesetzgebung entsprechend zu erfüllen. Durch veraltetes Gerät und längere Reaktionszeiten können Notlagen verschlimmert und Personal in Gefahr gebracht werden. Um diese Problematik zu entschärfen, greifen Feuerwehren auf Fördervereine und/oder Spenden zurück.
Aufgrund fehlender Investitionen von Seiten der Träger des Brandschutzes (Kommunen, Städte), ist es einigen Freiwilligen Feuerwehren heutzutage nicht mehr möglich, ihre Aufgaben wirkungsvoll und der Gesetzgebung entsprechend zu erfüllen. Durch veraltetes Gerät und längere Reaktionszeiten können Notlagen verschlimmert und Personal in Gefahr gebracht werden. Um diese Problematik zu entschärfen, greifen Feuerwehren auf Fördervereine und/oder Spenden zurück.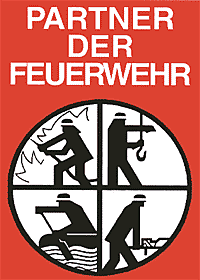 Auch durch die Arbeitsmarktsituation im 21. Jahrhundert wird die Einsatzfähigkeit von in vielen Ländern vorkommenden Freiwilligen Feuerwehren verringert. So wird manchen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten von ihren Arbeitgebern untersagt, während ihrer Arbeitszeit die Arbeit wegen eines Feuerwehreinsatzes zu verlassen, obwohl dies in einigen Ländern eindeutigen gesetzlichen Regelungen widerspricht. Auch das vermehrte Auspendeln zu den Arbeitsplätzen vermindert vor allem die Tagesbereitschaften. Zudem stellt die kontinuierlich notwendige Weiterbildung eine zusätzliche Belastung für bereits im Berufsleben geforderte Freiwillige dar.
Auch durch die Arbeitsmarktsituation im 21. Jahrhundert wird die Einsatzfähigkeit von in vielen Ländern vorkommenden Freiwilligen Feuerwehren verringert. So wird manchen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten von ihren Arbeitgebern untersagt, während ihrer Arbeitszeit die Arbeit wegen eines Feuerwehreinsatzes zu verlassen, obwohl dies in einigen Ländern eindeutigen gesetzlichen Regelungen widerspricht. Auch das vermehrte Auspendeln zu den Arbeitsplätzen vermindert vor allem die Tagesbereitschaften. Zudem stellt die kontinuierlich notwendige Weiterbildung eine zusätzliche Belastung für bereits im Berufsleben geforderte Freiwillige dar. Der größte Teil der Feuerwehrausbildung erfolgt, vor allem für Berufsfeuerwehren und die Kader der Freiwilligen Feuerwehren, in so genannten Feuerwehrschulen. In Hessen ist die die
Der größte Teil der Feuerwehrausbildung erfolgt, vor allem für Berufsfeuerwehren und die Kader der Freiwilligen Feuerwehren, in so genannten Feuerwehrschulen. In Hessen ist die die  Um die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen verfügt die Feuerwehr in der Neuzeit über eine Vielzahl von technischem Gerät, dies umfasst neben den Feuerwehrfahrzeugen auch deren Beladung und die persönliche Ausrüstung eines jeden Feuerwehrmannes/frau, die in einem so genannten Feuerhaus oder bei einer ständig besetzten Stelle, einer Feuerwache, untergebracht sind. Sie dient dazu, vor Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Übung und Einsatz zu schützen. In den meisten Ländern besteht diese aus einem Feuerwehrschutzanzug, einem Schutzhelm, Handschuhen und Sicherheitsschuhen.
Um die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen verfügt die Feuerwehr in der Neuzeit über eine Vielzahl von technischem Gerät, dies umfasst neben den Feuerwehrfahrzeugen auch deren Beladung und die persönliche Ausrüstung eines jeden Feuerwehrmannes/frau, die in einem so genannten Feuerhaus oder bei einer ständig besetzten Stelle, einer Feuerwache, untergebracht sind. Sie dient dazu, vor Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Übung und Einsatz zu schützen. In den meisten Ländern besteht diese aus einem Feuerwehrschutzanzug, einem Schutzhelm, Handschuhen und Sicherheitsschuhen. Bereits die alten Ägypter hatten die ersten organisierten Feuerlöscheinheiten.
Bereits die alten Ägypter hatten die ersten organisierten Feuerlöscheinheiten.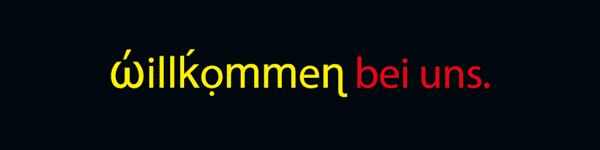
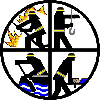 Die Aufgaben der Feuerwehren werden oft mit den Schlagworten „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ beschrieben. Bei den Werk- und Betriebsfeuerwehren steht der betriebliche Brandschutz im Vordergrund. Unter Umständen wirken Feuerwehren auch im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren mit und sind so auch im vorbeugenden Brandschutz tätig. Auf jeden Fall ist die Feuerwehr jedoch im Umweltschutz tätig, wozu nicht nur die Aufnahme von ausgelaufenem Öl nach Unfällen zählt.
Die Aufgaben der Feuerwehren werden oft mit den Schlagworten „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ beschrieben. Bei den Werk- und Betriebsfeuerwehren steht der betriebliche Brandschutz im Vordergrund. Unter Umständen wirken Feuerwehren auch im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren mit und sind so auch im vorbeugenden Brandschutz tätig. Auf jeden Fall ist die Feuerwehr jedoch im Umweltschutz tätig, wozu nicht nur die Aufnahme von ausgelaufenem Öl nach Unfällen zählt.