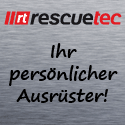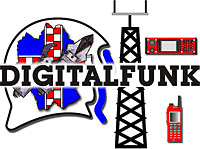
Um unseren Feuerwehren eine
Informationsplattform zum Thema „Digitalfunk“ zu bieten, haben wir diese Seite erstellt, die zunächst ein paar allgemeine Kurzinformationen enthält. Weiter unten sind entsprechende Links zu aktuellen Beiträgen sowie auch weiterführende Links zu entsprechenden Informationen beteiligter Behörden und Institutionen oder im Internet vorhandene Seiten mit tangierenden Daten auflistet.
Das Thema "Digitalfunk" ist in aller Munde. Er soll in Kürze den derzeitigen Analogfunk im Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ablösen. Bereits im Schengener Abkommen wurde der Wegfall der Grenzen innerhalb Europas vereinbart. Daher wird bei Grenzübertritten nur noch an den Außengrenzen von Europa kontrolliert. Dies bedingt, dass die Sicherheitskräfte zusammen kommunizieren müssen. Das war der Grundstein für die Diskussion Mitte der 90er Jahre bezüglich Einführung eines digitalen BOS-Funknetzes.
Das bisherige Analog-Funknetz funktioniert zwar noch, aber die meisten Geräte sind schon viele Jahre in Gebrauch. Bei den Feuerwehren sind zum Teil 20-30 Jahre alte Geräte vorhanden, die nunmehr oft nicht mehr zu reparieren sind, zumal die meisten Hersteller den Geräteservice eingestellt haben. Besonders die vielen Funkmeldeempfänger (Piepser), über die die Feuerwehrleute alarmiert werden, überaltern zusehends.
Mit dem digitalen Funknetz wird ein neues Zeitalter in der Kommunikationstechnik der BOS eingeläutet. Nach der Inbetriebnahme wird es
mit rund 500.000 Nutzern das weltweit größte Digitalfunknetz sein.

In Hessen wurde mit dem Netzaufbau 2010 begonnen.
2013/2014 soll das Netz hessenweit zur Nutzung zur Verfügung stehen. Nutzer dieses Funknetzes sind neben der Polizei und den Feuerwehren auch sämtliche weitere Hilfsorganisationen (DRK, Malteser, ASB, Johanniter, THW, Malteser, DLRG, Bergwacht, Rettungshubschrauber) und der Katastrophenschutz.

Das neue Digitalfunknetz bringt im Gegensatz zum bisherigen analogen Funknetz
eine Menge an Verbesserungen, wie z.B. Alarmierung mit Rückmeldemöglichkeit, Gruppenkommunikation auch BOS übergreifend nach Einsatzstellen geordnet, Möglichkeit von Zielrufen, verbesserte bundesweite Kommunikation, keine zwei unterschiedlichen Frequenzbereiche und so auch Kommunikation zwischen Fahrzeug- und Handsprechfunkgeräten, über einen weiten Bereich der Feldstärke gleichbleibende Sprachqualität, Telefonfunktion, automatische Zuweisungen von Sprechgruppen ohne besondere Bedienung, mehr Frequenzen und daher weniger Störungen, eindeutige Identifikation der Funkteilnehmer, verbesserte Status-Übertragungen, Möglichkeit von Datenübertragungen und somit auch Abfragen von Datenbanken, Übertragung von Sprache und Daten gleichzeitig, abhörsichere Übertragungswege, Versenden von alphanummerischen Kurznachrichten, automatische Zellwechsel bei laufender Verbindung, Prioritätsrufe, u.v.m.
Da in Hessen auch die Alarmierung über den digitalen Standard TETRA erfolgen soll, ist im Vergleich mit anderen Bundesländern in Hessen eine höhere Kategorie nach GAN (Gruppe Anforderungen an das Netz) und somit ein dichteres Netz an Basisstationen erforderlich. Dies bringt eine wesentlich bessere Funkversorgung mit sich, so dass die Versorgung mindestens so gut, wie im derzeitigen analogen Netz bzw. sogar noch besser sein dürfte.
Als Mindeststandard wurde bundesweit eine Funkversorgung der Kategorien 0 (Fahrzeugfunkversorgung) und 1 (Handsprechfunkgeräte Kopftrageweise außerhalb von Gebäuden) mit einer Orts-/Zeit-Wahrscheinlichkeit von 96 % definiert.
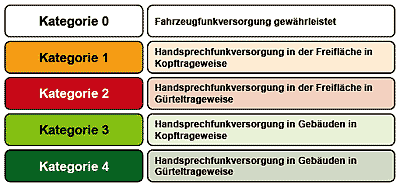
Für Hessen ist flächendeckend Kat. 0 und in Siedlungsgebieten sogar Kat. 2 (Handfunkgeräte in Gürteltrageweise außerhalb von Gebäuden) vorgesehen. Die Großstädte (15 festgelegte Bereiche) sollen in Kat. 4 (Handfunkgeräte in Gürteltrageweise innerhalb von Gebäuden) versorgt werden.
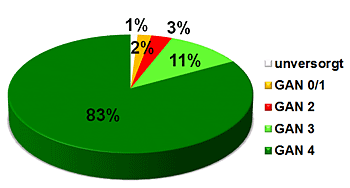
Nach dem Stand der Planungen wird bei der Versorgung in Hessen trotz der Forderung Kat. 2 überwiegend sogar Kat. 4 erreicht wird. Selbst auf dem flachen Land liegt die Versorgung nach Kat. 4 bei über 80% der Fläche. Einige wenige kleine „weiße“ Flecken gilt es noch zu füllen, wobei anzumerken ist, dass noch nicht alle Standorte geplant sind.
Insgesamt sind für Hessen nach dem Stand Anfang 2010 ca. 420 Basisstationen geplant. In Hessen wird es 5 Standorte für Vermittlungsstellen geben.















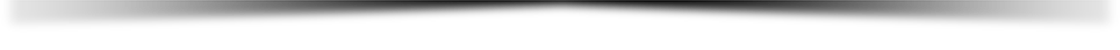
 Unsere Bildergalerie befindet sich auf
Unsere Bildergalerie befindet sich auf 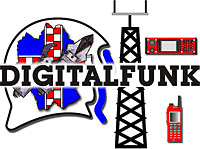 Um unseren Feuerwehren eine Informationsplattform zum Thema „Digitalfunk“ zu bieten, haben wir diese Seite erstellt, die zunächst ein paar allgemeine Kurzinformationen enthält. Weiter unten sind entsprechende Links zu aktuellen Beiträgen sowie auch weiterführende Links zu entsprechenden Informationen beteiligter Behörden und Institutionen oder im Internet vorhandene Seiten mit tangierenden Daten auflistet.
Um unseren Feuerwehren eine Informationsplattform zum Thema „Digitalfunk“ zu bieten, haben wir diese Seite erstellt, die zunächst ein paar allgemeine Kurzinformationen enthält. Weiter unten sind entsprechende Links zu aktuellen Beiträgen sowie auch weiterführende Links zu entsprechenden Informationen beteiligter Behörden und Institutionen oder im Internet vorhandene Seiten mit tangierenden Daten auflistet. Das neue Digitalfunknetz bringt im Gegensatz zum bisherigen analogen Funknetz eine Menge an Verbesserungen, wie z.B. Alarmierung mit Rückmeldemöglichkeit, Gruppenkommunikation auch BOS übergreifend nach Einsatzstellen geordnet, Möglichkeit von Zielrufen, verbesserte bundesweite Kommunikation, keine zwei unterschiedlichen Frequenzbereiche und so auch Kommunikation zwischen Fahrzeug- und Handsprechfunkgeräten, über einen weiten Bereich der Feldstärke gleichbleibende Sprachqualität, Telefonfunktion, automatische Zuweisungen von Sprechgruppen ohne besondere Bedienung, mehr Frequenzen und daher weniger Störungen, eindeutige Identifikation der Funkteilnehmer, verbesserte Status-Übertragungen, Möglichkeit von Datenübertragungen und somit auch Abfragen von Datenbanken, Übertragung von Sprache und Daten gleichzeitig, abhörsichere Übertragungswege, Versenden von alphanummerischen Kurznachrichten, automatische Zellwechsel bei laufender Verbindung, Prioritätsrufe, u.v.m.
Das neue Digitalfunknetz bringt im Gegensatz zum bisherigen analogen Funknetz eine Menge an Verbesserungen, wie z.B. Alarmierung mit Rückmeldemöglichkeit, Gruppenkommunikation auch BOS übergreifend nach Einsatzstellen geordnet, Möglichkeit von Zielrufen, verbesserte bundesweite Kommunikation, keine zwei unterschiedlichen Frequenzbereiche und so auch Kommunikation zwischen Fahrzeug- und Handsprechfunkgeräten, über einen weiten Bereich der Feldstärke gleichbleibende Sprachqualität, Telefonfunktion, automatische Zuweisungen von Sprechgruppen ohne besondere Bedienung, mehr Frequenzen und daher weniger Störungen, eindeutige Identifikation der Funkteilnehmer, verbesserte Status-Übertragungen, Möglichkeit von Datenübertragungen und somit auch Abfragen von Datenbanken, Übertragung von Sprache und Daten gleichzeitig, abhörsichere Übertragungswege, Versenden von alphanummerischen Kurznachrichten, automatische Zellwechsel bei laufender Verbindung, Prioritätsrufe, u.v.m.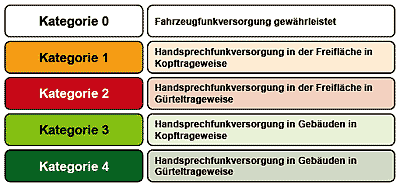 Für Hessen ist flächendeckend Kat. 0 und in Siedlungsgebieten sogar Kat. 2 (Handfunkgeräte in Gürteltrageweise außerhalb von Gebäuden) vorgesehen. Die Großstädte (15 festgelegte Bereiche) sollen in Kat. 4 (Handfunkgeräte in Gürteltrageweise innerhalb von Gebäuden) versorgt werden.
Für Hessen ist flächendeckend Kat. 0 und in Siedlungsgebieten sogar Kat. 2 (Handfunkgeräte in Gürteltrageweise außerhalb von Gebäuden) vorgesehen. Die Großstädte (15 festgelegte Bereiche) sollen in Kat. 4 (Handfunkgeräte in Gürteltrageweise innerhalb von Gebäuden) versorgt werden.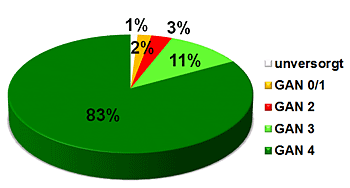 Nach dem Stand der Planungen wird bei der Versorgung in Hessen trotz der Forderung Kat. 2 überwiegend sogar Kat. 4 erreicht wird. Selbst auf dem flachen Land liegt die Versorgung nach Kat. 4 bei über 80% der Fläche. Einige wenige kleine „weiße“ Flecken gilt es noch zu füllen, wobei anzumerken ist, dass noch nicht alle Standorte geplant sind.
Nach dem Stand der Planungen wird bei der Versorgung in Hessen trotz der Forderung Kat. 2 überwiegend sogar Kat. 4 erreicht wird. Selbst auf dem flachen Land liegt die Versorgung nach Kat. 4 bei über 80% der Fläche. Einige wenige kleine „weiße“ Flecken gilt es noch zu füllen, wobei anzumerken ist, dass noch nicht alle Standorte geplant sind.